1986: »Durch den Einsatz von Computern können sich Störungen auf einem Markt wie eine Springflut binnen Stunden über den ganzen Erdball ausbreiten.«Karl Miesel, Vorstandssprecher der Schweizerischen Kredit-Anstalt Deutschland AG
Der Ausverkauf der Gegenwart
 New York. Donnerstag, 9. Januar 1987. Das neue Börsenjahr begann mit einem
Paukenschlag. Der Dow Jones
hatte erstmals in seiner Geschichte die 2000er Marke überschritten. Mit dem
Schlußstand von 2005.91 hatte er die nächste große Hürde genommen. Der Jubel
war groß. »Von der Empore regnete es Konfetti und vor dem Börsengebäude wurden
dicke Zigarren geraucht«, schrieb die FAZ.[1]
New York. Donnerstag, 9. Januar 1987. Das neue Börsenjahr begann mit einem
Paukenschlag. Der Dow Jones
hatte erstmals in seiner Geschichte die 2000er Marke überschritten. Mit dem
Schlußstand von 2005.91 hatte er die nächste große Hürde genommen. Der Jubel
war groß. »Von der Empore regnete es Konfetti und vor dem Börsengebäude wurden
dicke Zigarren geraucht«, schrieb die FAZ.[1]
Systematisch hatte die Börse 1986 daraufhin gearbeitet. Sie hatte
sogar verkraftet, dass IBMs Börsenkapitalisierung im Jahr zuvor um 24 Prozent
oder 22,5 Milliarden Dollar gefallen war ‑ der größte Verlierer des Jahres.
Dabei hatte Big Blues am 3.
Juni 1986 zur Stabilisierung ihres Kurses zehn Millionen ihrer eigenen Aktien
gekauft. Doch ihre Aktie war seitdem von 151,325 Dollar auf 122 Dollar
gefallen. Voller Pessimismus waren die Analysten, obwohl Big Blue verkündet hatte, 10.000
Mitarbeiter in den vorzeitigen Ruhestand zu entlassen, die Kapitalausgaben
um 1,5 Milliarden zu senken und weitere 15 Millionen eigene Aktien zu kaufen.[2] Doch nach
dem Erreichen des 2000ers nahm die Börse Big
Blue wieder in ihre Arme und trieb den Kurs in den folgenden Monaten
zu ungeahnten Höhen. Vergessen war, dass IBM mit dem Ausverkauf ihrer Mietbasis
in der ersten Hälfte der achtziger Jahre mächtig an Substanz verloren hatte.
Noch einmal wurde die Alte IBM gefeiert, der Aktienkurs bis August 1987 auf
mehr als 170 Dollar hochgetrieben. Dann allerdings sollte der Crash kommen, der diese Firma in die
größte Krise des Computerzeitalters stürzte.
Nein, die Zukunft schlägt sich ihre Bahn nicht gradlinig durch die
Geschichte ‑ auch wenn die historischen Zahlenvergleiche, in denen sich Preis
und Leistung der Rechner in atemberaubender Weise widerspiegeln, eine
Gesetzmäßigkeit suggerieren möchten. Gewaltige Friktionen, Crashs, begleiten die Computerbranche
auf ihrem Weg. Diese sind sogar entscheidend.
IBMs Desaster begann mit dem Sturz der Computergötter bei ihren Kunden.
Die DV‑Profis waren die ersten, die es in den achtziger Jahren erwischte. Sie
hatten es sich wunderbar bequem in der IBM‑Welt eingerichtet. Gerade noch waren
sie eine elitäre Zunft für sich gewesen. Eine Technologie‑Generation nach
der anderen hatten sie gemeinsam mit Big
Blue grandios gemeistert. Relais, Röhren, Transistoren und
Integrierte Schaltkreise. Mit jedem Wechsel wuchs die Macht der Computer und
der IBM als Ordnungsfaktor. Programmierer waren so begehrt, dass ihnen
zu Beginn der achtziger Jahre die Anwenderfirmen eine Drei‑Tage‑Woche bei
vollem Lohnausgleich anboten, Einstellungsgespräche nicht selten auf den
Bermudas stattfanden und Headhunter
die Edelprofis von einem Job zum nächsten weitervermittelten. Der
Personalmarkt für die Informatikgilde boomte. Jeder Wunsch wurde den Hohepriestern
des High‑Techs von den Lippen
abgelesen. Und die Krönung war ein Job bei IBM.
Was war der Grund? Zwar ein Kind unbändiger Dynamik und Innovationsfreude,
war der Computer letztlich das Instrument einer statisch konditionierten
Wirtschaft, die sich selbst nach der Ölkrise nicht grundlegend ändern wollte.
Die Datenverarbeitung sollte vor allem die bestehenden Organisationen schützen
& stützen. Nur die Mächtigen konnten sich bis dahin diese teuren Rechner
und die noch aufwendigere Software leisten. Mit dieser Strategie hatten sie
bislang alle Krisen sauber überstanden ‑ und das hatte das Vertrauen in die
institutionelle Macht der Computer und der IBM ins Unermeßliche steigern lassen.
Backlogs von drei Jahren waren
in der Anwendungsentwicklung keine Seltenheit. Im Vergleich zu dem, was eine
völlige Reorganisation und Restrukturierung ihrer Betriebe gekostet hätte,
war jeder Preis gerechtfertigt. Das galt auch für die überzogenen Gehaltswünsche
der Computerleute. Die Effizienzsteigerungen, die sie erzielten, waren
einfach sensationell. Es war die Hochzeit der Rationalisierung. Aber es
war auch eine geschlossene Welt. Der Genius des Computers hatte sich noch nicht
auf die äußere Welt, die Märkte, übertragen. Das war einer der Gründe gewesen, dass
sich in den siebziger Jahren die Börse so schlapp entwickelt hatte.
Mit dem 12. August 1981, der Ankündigung des PCs durch IBM, sollte sich
dies alles ändern. Von diesem Tag an wurde die Geschichte der
Datenverarbeitung in zwei Zeitalter aufgeteilt: davor & danach. Genauso
könnte man auch die Wirtschaftsgeschichte dividieren. IBM, die Hochburg des institutionellen & professionellen
Computereinsatzes, war von diesem Umschwung selbst am meisten überrascht. Mit
dem PC veränderte sich unwiderruflich das Soziogramm der DV‑Leute.
Die schnell wachsende Zahl der preiswerten Rechner überstieg die Fähigkeit
der Profis, sie zu beherrschen und organisatorisch einzubinden. Die Effizienzgewinne
schmolzen dahin, je mehr dieser Dinger eingesetzt wurden. Die Benutzer
hatten den Computer entdeckt. Sie waren zum Entsetzen der Profis die neuen
Helden. Sie kümmerten sich nicht um die betriebliche Effizienz, sondern um
ihre ganz persönliche Effektivität. Endlich besaßen sie selbst ein solches
Wunderding auf ihrem Schreibtisch, mit dem sie ihren persönlichen Wert
erhöhen konnten. Sie wurden ihre eigenen Experten der neuen Technologie, die
sie mitunter besser verstanden als das DV‑Establishment ‑ und als IBM. Die alte, starre Ordnung, die in
ihrer Reichweite alle Unternehmensteile zu integrieren suchte, trieb ihrem
Ende entgegen.
Vielen Firmen, so meinte Randy
J. Goldfield, Präsident der New Yorker Beratungsfirma Omni Group Ltd., bliebe nichts
anderes übrig als »neue Organisationen zu errichten, die das neue Gerät unterstützen«.[3]
Aber eine neue Organisation war nun wirklich das Allerletzte, was die
Unternehmen wollten. Auch IBM nicht. Ihre PC‑Truppe, die sich anfangs völlig
losgelöst von Armonk im Markt
ausgebreitet hatte, war längst zurückgepfiffen worden. Nun bestimmten die
alten Monopol‑Strategen, wie ein PC zu vermarkten sei.
Je mehr die PC‑Anwender die innere Ordnung der Unternehmen besetzten,
desto stärker flüchteten die Computerprofis in scheinbar so esoterische Themen
wie Künstliche Intelligenz, Expertensysteme, Netztopologien und Datenmodellierung.
Immer raffinierter wurden die Programme, die sie austüftelten. Jeder suchte
nach Theorien und Mechanismen, mit der nicht nur Unternehmen, sondern die
ganze Welt beherrschbar wurden. Doch mit jedem Erkenntnisschritt verließen sie
die Mauern ihrer alten Welt und begannen mit dem Aufbau einer neuen
Infrastruktur. In ihr sollten sich alle ‑ wie von einer unsichtbaren Hand
gelenkt ‑ wiedervereinigt sehen.
Was die Computerprofis betrieben, war die Globalisierung der Datenverarbeitung,
die Vernetzung der Welt. Aber sie begingen dabei einen fatalen Fehler. Sie
versuchten, diese Netze gleichförmig zu gestalten. Gesetzmäßigkeit war ihr
professioneller Anspruch ‑ nicht dass er scheiterte, sollte ihre
Glaubwürdigkeit erschüttern, sondern dass er ihnen zu gut gelang. Dafür ist
der Börsenkrach von Oktober 1987 Beispiel
& Beweis. Doch wohl jedes Unternehmen hat seitdem einen Minicrash erlebt.
Die Globalisierung war nicht das Verdienst der Benutzer. Diese setzten
auf Individualisierung. Nein, dahinter stand der Gegenschlag der
Computerprofis, die hier ein neues Terrain für Effizienzgewinne gefunden
hatten. Nun entfaltete sich eine Dialektik, die eine unglaubliche Wirkung auf
die gesamte Wirtschaftswelt haben sollte: die Eskalation von Globalisierung
& Individualisierung. Sie ist die Ursache für den Crash ‑ auch der Alten IBM.
Je größer die Reichweite der Systeme wurde, desto kürzer wurden die
Zeitzyklen, in denen Menschen agieren mußten. Nirgendwo war dies so zu spüren
wie an den Kapitalmärkten. Und dieser Wettlauf mußte irgendwann einmal kollabieren.
Genau das geschah mit dem Crash
vom 19. Oktober 1987. An diesem Tag erlebten die Computerprofis und die
Börsenprofis, die Broker, ein
beispielloses Desaster: die Gleichschaltung von Globalisierung & Individualisierung.
Das institutionelle Denken in immer größeren geographischen Räumen
kollidierte in einem globalen Kurzschluß mit dem individuellen Agieren in
immer kleineren Zeiträumen. Anders formuliert: die Profis in beiden Lagern
zerstörten sich selbst. Was war geschehen?
 Zwischen 1982 und 1987 war in den USA die Zahl der registrierten Broker
von 240.000 auf 402.000 gestiegen, in New York allein stieg die Zahl der
Beschäftigten von 150.000 auf mehr als eine viertel Million. Nie zuvor
konkurrierten landesweit soviele Händler um das Geld der Anleger. Die Werbebudgets
waren im selben Zeitraum um 120 Prozent auf 720 Millionen Dollar gestiegen,
während gleichzeitig der Wettkampf um die Konditionen immer heftiger
wurde. [4] Die
Folge: durch massiven Computereinsatz wollten die Investmenthäuser die
Erosion ihrer Gewinne kompensieren. Eine Branche stand unter Dampf.
Zwischen 1982 und 1987 war in den USA die Zahl der registrierten Broker
von 240.000 auf 402.000 gestiegen, in New York allein stieg die Zahl der
Beschäftigten von 150.000 auf mehr als eine viertel Million. Nie zuvor
konkurrierten landesweit soviele Händler um das Geld der Anleger. Die Werbebudgets
waren im selben Zeitraum um 120 Prozent auf 720 Millionen Dollar gestiegen,
während gleichzeitig der Wettkampf um die Konditionen immer heftiger
wurde. [4] Die
Folge: durch massiven Computereinsatz wollten die Investmenthäuser die
Erosion ihrer Gewinne kompensieren. Eine Branche stand unter Dampf.
Der Höhenflug der Börse schien dabei jede Kapitalinvestition ebenso zu
rechtfertigen wie die massive Aufblähung mit Personal. Der Dow Jones‑Index
eilte von einer Rekordhöhe zur nächsten. Zwischen August 1982 und August 1987
legte er 1900 Punkte zu. Selbst wenn man nicht den absoluten Anstieg rechnete,
sondern nur relativ Maß nahm, dann war der Zuwachs des Indexes mit 246 Prozent
immer noch beachtlich. Nur dreimal zuvor in der Geschichte der New Yorker
Börse hatte es einen stärkeren Aufwärtstrieb gegeben:
In den acht Jahren vor dem Crash von 1929 hatte der Dow Jones
ein Anstieg um 496 Prozent gefeiert.
Zwischen 1933 und 1937 befreite sich Amerikas Wirtschaft von der großen
Depression mit einem Steigflug des Indexes um 355 Prozent.
Zwischen 1949 und 1961 triumphierte der Dow Jones mit einer
Zunahme um 288 Prozent über die Nachkriegswelt, die voller Achtung auf das
Wunderland USA schaute.
Waren diese historischen Höhenflüge jeweils ein Ausdruck gewesen für
die in Schüben stattfindende Reindustrialisierung Amerikas, so stand die fünf
Jahre dauernde Hausse unter einem völlig neuen Zeichen: die
Deindustralisierung der USA hatte begonnen. Das zeigte sich im Konsumverhalten
der Bevölkerung. Der Verbrauch war die treibende Kraft, der jährlich um drei
Prozent stieg. Dabei gewannen die Ausgaben für Dienstleistungen ein leichtes
Übergewicht.
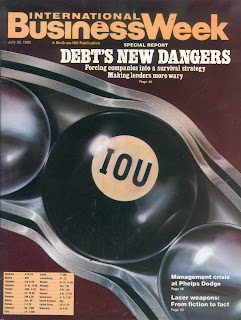 Dieser
Aufschwung war kredit ‑ und konsumfinanziert. Es herrschte eine
Stimmung, die getragen war von der Erkenntnis, dass man an den
Verhältnissen
nur etwas verändern konnte, wenn man die ihnen zugrundeliegenden Werte
verscherbelte.
Im Prinzip spielten alle IBM, die in der ersten Hälfte der achtziger
Jahre ihre
Mietbasis verkauft hatte. 1984 erreichte die Gesamtverschuldung der
Vereinigten Staaten, Haushalte, Firmen und Behörden, das Rekordvolumen
von 7,1
Billionen Dollar. Das war ein Anstieg um 14 Prozent. Zu meistern war
dieser
Schuldenberg, der das Bruttosozialprodukt um den Faktor 1,95 übertraf,
nur dadurch,
dass alle Vermögenswerte in immer schnellerer Abfolge hin und her
transferiert
wurden. Ständig wurden neue Finanztricks ausgedacht. »Wir sind
Experten im
Handel mit allen Finanzwerten und Firmenwerten geworden, aber derweil
fallen
wir bei der Produktivität zurück«, klagte 1985 der damalige
Präsident der Federal Reserve Bank, Paul A. Volcker. Der Chefvolkswirt
der First Boston Corp., Albert M. Wojnilower, warnte: »Man
kann einwenden, was man will, und erklären, dass dies angestoßen wird
durch
die Freiheit der Märkte, aber Tatsache ist und bleibt, dass wir nicht
diese
hohen Transaktionsvolumina benötigen, um damit unser Volkseinkommen zu
steuern.«[5] Darum
ging es auch gar nicht. Das Spekulationsfieber hatte Amerika erfaßt ‑ vor allem
aber die Börsenprofis. Sie ermunterten, ja sie zwangen Konzernchefs, ihr Geld
in waghalsige Transaktionen & Takeover hineinzuwerfen, anstatt
es langfristig in ihren Betrieben anzulegen. Die Wirtschaft konsumierte
Unternehmen, die Bevölkerung ihre Sparguthaben.
Dieser
Aufschwung war kredit ‑ und konsumfinanziert. Es herrschte eine
Stimmung, die getragen war von der Erkenntnis, dass man an den
Verhältnissen
nur etwas verändern konnte, wenn man die ihnen zugrundeliegenden Werte
verscherbelte.
Im Prinzip spielten alle IBM, die in der ersten Hälfte der achtziger
Jahre ihre
Mietbasis verkauft hatte. 1984 erreichte die Gesamtverschuldung der
Vereinigten Staaten, Haushalte, Firmen und Behörden, das Rekordvolumen
von 7,1
Billionen Dollar. Das war ein Anstieg um 14 Prozent. Zu meistern war
dieser
Schuldenberg, der das Bruttosozialprodukt um den Faktor 1,95 übertraf,
nur dadurch,
dass alle Vermögenswerte in immer schnellerer Abfolge hin und her
transferiert
wurden. Ständig wurden neue Finanztricks ausgedacht. »Wir sind
Experten im
Handel mit allen Finanzwerten und Firmenwerten geworden, aber derweil
fallen
wir bei der Produktivität zurück«, klagte 1985 der damalige
Präsident der Federal Reserve Bank, Paul A. Volcker. Der Chefvolkswirt
der First Boston Corp., Albert M. Wojnilower, warnte: »Man
kann einwenden, was man will, und erklären, dass dies angestoßen wird
durch
die Freiheit der Märkte, aber Tatsache ist und bleibt, dass wir nicht
diese
hohen Transaktionsvolumina benötigen, um damit unser Volkseinkommen zu
steuern.«[5] Darum
ging es auch gar nicht. Das Spekulationsfieber hatte Amerika erfaßt ‑ vor allem
aber die Börsenprofis. Sie ermunterten, ja sie zwangen Konzernchefs, ihr Geld
in waghalsige Transaktionen & Takeover hineinzuwerfen, anstatt
es langfristig in ihren Betrieben anzulegen. Die Wirtschaft konsumierte
Unternehmen, die Bevölkerung ihre Sparguthaben. // Teil 1 // Teil 2 // Teil 3 // Teil 4 // Teil 5 // Teil 6
[1] Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.1.1987: »Im Börsensaal Jubel
wie beim Football«
[2] Wall Street Journal, 13.1.1987, Dennis Kneale; »Some Analysts feat
IBM's Blues only began with last year's setback«
[3] Business Week, 8.8.83: »Computer shock hits the office«
[4] Business Week, 23.11.87, Mark N. Vamos, David Zigas, Leslie
Helm, Jeffrey M. Laderman, James E. Ellis: »Wall Street's credibility gab«
[5] Business Week, 16.9.85, Anthony Bianco: »Playing with fire«

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen